Was tun, wenn das Gegenüber abstruse Behauptungen aufstellt? Katharina Nocun erklärt, wie man Argumente gegen Verschwörungserzählungen gut zur Geltung bringt.
Als Barbara Wimmer eine Bäckerei am Bahnhof des Wiener Randbezirks Hütteldorf betritt, ist sie in Gedanken bereits bei der Wanderung, die sie für den Tag geplant hat. Plötzlich dreht sich die Frau vor ihr in der Schlange zu ihr um und verwickelt sie in ein Gespräch. Sie behauptet, Corona werde durch den neuen Mobilfunkstandard 5G verursacht.
Barbara Wimmer fasst sich ein Herz und fängt an, dagegen zu argumentieren. Als Technik-Journalistin kennt sie sich mit der 5-G-Technologie ziemlich gut aus. Doch das Ergebnis ist niederschmetternd: „Dann ist sie richtig hysterisch geworden, und ab einem gewissen Punkt habe ich mich entschieden, wegzugehen.“
Wer aus heiterem Himmel mit Verschwörungserzählungen konfrontiert wird, fühlt sich schnell überfordert. Lohnt es überhaupt, dagegen zu halten? Schließlich ist meist absehbar, dass Gespräche mühsam und anstrengend werden. Gerade im privaten Umfeld besteht das Risiko, dass man sich damit nicht unbedingt Freund:innen macht.
Wäre Schweigen nicht einfacher?
Die Hoffnung, das Problem würde von allein verschwinden, ist trügerisch. Der Glaube an eine einzelne Verschwörungserzählung kann nämlich dazu führen, dass mit der Zeit weitere, immer krassere Behauptungen für wahr gehalten werden. Einschlägige Gruppen auf Telegram & Co. präsentieren eine Welt, in der so gut wie alles durch Verschwörungen vermeintlich erklärt wird. Je mehr Zeit verstreicht, desto schwieriger wird es oft, dagegen anzukommen.
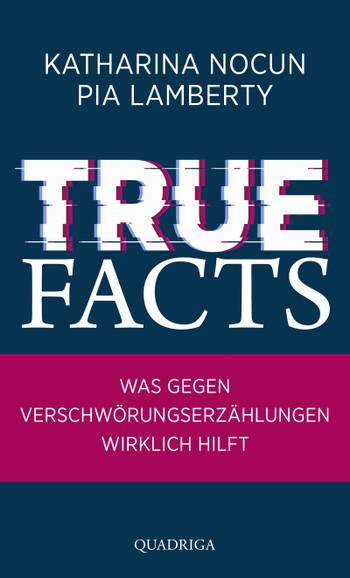
Dieser Text ist eine gekürzte und überarbeitete Fassung aus Katharina Nocuns Buch „True Facts. Was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft“ (mit Pia Lamberty, Quadriga 2021, 12 Euro). Mehr Infos beim Verlag.
Darum ist schnelles Eingreifen ratsam. Im Vergleich zu einer zufälligen Begegnung in einer Bäckerei ist man bei Debatten im Freundes- oder Familienkreis zudem klar im Vorteil. Hier gibt es ein Vertrauensverhältnis, auf dem sich aufbauen lässt. Selbst wenn Medien, Wissenschaft und Politik generell misstraut wird, bleibt das private Umfeld oft die letzte Instanz, die noch andere Perspektiven aufzeigen kann.
Tipp Nr. 1: Finde heraus, womit du es zu tun hast
Es macht einen großen Unterschied, ob jemand eine Verschwörungserzählung nur aufgeschnappt hat oder ob dahinter eine tiefere Überzeugung steckt. Daher gilt es zunächst herauszufinden, wo der oder die andere steht: „Was glaubst du genau? Woher hast du das? Wie lange glaubst du das schon?“ So bekommt man ein Gespür für die Situation. Ist es mit einem einfachen Faktencheck getan oder sollte man sich auf langwierige Debatten einstellen? Beratungsstellen raten bei einer stark gefestigten Überzeugung davon ab, weiter inhaltlich zu diskutieren. Stattdessen werden Ansätze empfohlen, die auf emotionaler Ebene ansetzen (siehe S. 26). Das leuchtet ein: Wie soll man noch sachlich diskutieren, wenn der andere jeder seriösen Quelle misstraut?
Tipp Nr. 2: Der Ton macht die Musik
Einige neigen dazu, direkt auf Angriff zu schalten. „Wie kannst du nur so einen Quatsch glauben?“, wird dem anderen entgegengeschleudert. Doch verletzende Worte führen zu einer Abwehrhaltung und lassen Gespräche schnell eskalieren. Auch wenn es schwerfällt, gilt es, sich zu zügeln. Das heißt: Abwertungen vermeiden und nicht von oben herab dozieren. Wer sachlich und ruhig argumentiert, unterstreicht seine Argumente viel effektiver. Dass man eine andere Meinung hat, sollte allerdings deutlich gesagt werden. Bei aller Dialogbereitschaft gilt es außerdem, über menschenfeindliche Aussagen (z. B. Rassismus, Antisemitismus) nicht einfach hinwegzugehen, sondern klar Gegenrede zu betreiben.
Tipp Nr. 3: Setze dir ein realistisches Ziel
Sich einzugestehen, dass man sich in etwas verrannt hat, ist ein extrem unangenehmes Gefühl. Kein Wunder also, dass dieser Prozess viel Überwindung kostet. Statt sich mit der Erwartung unter Druck zu setzen, den anderen in wenigen Minuten oder Stunden umzustimmen, sollte man sich daher lieber realistische Ziele setzen. Etwa: „Heute will ich ein gutes Argument oder eine gute Quelle einbringen.“ Es ist außerdem ratsam, solche Gespräche eher unter vier Augen zu führen. Das Ziel bei Gruppendiskussionen sollte vor allem darin bestehen, den Umstehenden deutlich zu machen: „Nicht jede:r glaubt so etwas!“ So wird die Verbreitung von Falschinformationen eingedämmt.
Tipp Nr. 4: Mache klar, die Welt ist nicht schwarz-weiß
Verschwörungserzählungen teilen die Welt in Gut und Böse ein. Schnell wird da pauschal über „die Medien“ oder „die Politik“ hergezogen. Bei solchen Verallgemeinerungen lohnt es sich reinzugrätschen. Auch Journalist:innen machen Fehler – aber lässt sich daraus ableiten, dass alle Medien lügen? In der Politik gibt es Korruptionsskandale, und die Reaktionen darauf lassen oft zu wünschen übrig – aber sollte man daraus schließen, dass alle Lokalpolitiker:innen insgeheim eine böswillige Agenda verfolgen? So wird angeregt, stark vereinfachte Weltbilder zu hinterfragen.
Tipp Nr. 5: Wähle deine Quellen weise
Ein gefestigtes verschwörungsideologisches Weltbild geht meist mit einer Ablehnung seriöser Medien und Wissenschaft einher. In der Praxis stößt man aber eher selten auf so extreme Ansichten. Gibt es seriöse Personen oder Medien, die beim Anderen einen Stein im Brett haben? Wer Quellen anführt, die beim Anderen Vertrauen genießen, wird es in der Regel leichter haben.
Tipp Nr. 6: Betone Gemeinsamkeiten
Viele neigen dazu, Verschwörungsgläubige als Menschen zu sehen, die quasi auf einem anderen Planeten leben. Doch am Anfang der Beschäftigung mit abseitigen Thesen stehen oft nachvollziehbare Fragen.
Etwa: „Warum ist der Reichtum in der Welt ungleich verteilt?“ Wenn Debatten hitzig werden, kann das Betonen von Gemeinsamkeiten die Gemüter abkühlen. Verschwörungsgläubige haben zudem oft falsche Vorstellungen von der Haltung anderer. Es lohnt sich daher klarzumachen: „Nur weil ich deine Geschichte nicht glaube, heißt das nicht, dass ich blind Unternehmen oder Regierungen vertraue. Ich denke eben nur, es gibt eine andere Erklärung.“
Tipp Nr. 7: Stelle Fragen
Fragen signalisieren dem Gegenüber ein aufrichtiges Interesse. Wer bei Details gezielt nachhakt, kann zudem auf logische Fehler aufmerksam machen. „Wie soll das konkret funktionieren? Ist das überhaupt plausibel?“ Viele Verschwörungsgläubige sind felsenfest überzeugt, besonders offen für neue Informationen zu sein. Daran zu appellieren kann ein äußerst wirkmächtiger Hebel sein. Daher lohnt sich die Frage: „Was würde dich vom Gegenteil überzeugen?“ Frage-Strategien sollten allerdings eher nicht in Gruppen eingesetzt werden – sonst rollt man den roten Teppich für die Verbreitung von Falschinformationen in großer Runde aus.
Tipp Nr. 8: Gespräche auch mal vertagen
Es ist nachvollziehbar, wenn man sich erst einmal überfordert fühlt. Eine Möglichkeit zum Umgang damit ist zu sagen: „Das hört sich für mich erst einmal unplausibel an. Ich muss mir das in Ruhe anschauen.“ Anschließend sollten Informationen und Faktenchecks recherchiert werden. Auch wenn der Ton rauer wird, sollte das Gespräch lieber vertagt werden – damit man später mit kühlem Kopf von Neuem ansetzen kann. Meist ist es mit einer einzigen Diskussion nicht getan. Daher sollte es auch nicht darum gehen, am Ende des Gesprächs um jeden Preis als derjenige dastehen zu wollen, dem recht gegeben wurde. Vielmehr gilt es, Brücken zu bauen, die womöglich erst später von Nutzen sein werden. Manchmal hilft es, den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Wenn zuvor geglaubte Behauptungen sich offensichtlich als Fake entpuppen, ist der andere womöglich plötzlich offen für Argumente, die er zuvor ignoriert hat.
Der Weg hinaus aus dem Kaninchenbau des Verschwörungsglaubens dauert manchmal genauso lange wie der Weg hinein. Und einige – da sollte man sich nichts vormachen – finden auch gar nicht mehr hinaus. Wenn Argumente regelmäßig abprallen, kann man schließlich auch die Entscheidung treffen, das Thema ruhen zu lassen und sich auf die Aufrechterhaltung des Kontakts beschränken – in der Hoffnung, dass eines Tages doch Zweifel aufkeimen. Keine Frage, das Ganze ist – besonders wenn es um Menschen geht, die für uns die Welt bedeuten – immens aufreibend. Aber zumindest den Versuch zu wagen, ist eben auch ein Zeichen dafür, dass einem etwas an der anderen Person liegt. Selbst wenn dieser Mensch das in dem Moment wahrscheinlich nicht erkennen wird.



