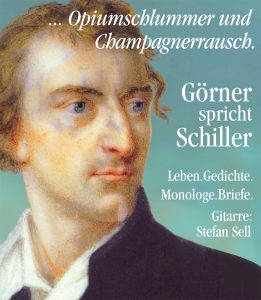Oktober 2010
Kicken an der Copacabana
Seit sieben Jahren fährt Hinz&Kunzt-Fotograf Mauricio Bustamante zur Fußball-Weltmeisterschaft der Obdachlosen. Begeistert hat er uns vom diesjährigen „Homeless World Cup“ in Rio de Janeiro erzählt, von Fußball am Strand und geplatzten Träumen.
 Erst beim Ausflug auf den Zuckerhut haben die deutschen Spieler gemerkt, dass sie wirklich in Rio de Janeiro sind. Bis dahin waren sie die ganze Zeit auf dem Turnierplatz gewesen. Aber an diesem Tag sind die sechs Spieler, ihr Trainer Stefan Huhn und Katrin Kretschmer, die Teamleiterin, mit der Seilbahn auf den Zuckerhut gefahren. Als wir oben waren, wollte ich ein Foto machen, dafür haben alle ihre Trikots angezogen. Und plötzlich war die Hölle los: Brasilianische Kinder kamen auf uns zugestürmt, alle wollten mit den Spielern fotografiert werden. Auf einmal wurden die Jungs behandelt wie richtige Stars! Die Stimmung war in Rio die ganze Zeit über genial. Die beiden Spielfelder waren am Strand von Copacabana aufgebaut – eine unglaubliche Kulisse. Es war angenehm warm, die Leute sind nach jedem Spiel ins Meer gesprungen. Rund um das Turniergelände spielten die Kinder im Sand Fußball – und abends haben sie gebettelt, dass sie noch mit dem deutschen Team kicken durften.
Erst beim Ausflug auf den Zuckerhut haben die deutschen Spieler gemerkt, dass sie wirklich in Rio de Janeiro sind. Bis dahin waren sie die ganze Zeit auf dem Turnierplatz gewesen. Aber an diesem Tag sind die sechs Spieler, ihr Trainer Stefan Huhn und Katrin Kretschmer, die Teamleiterin, mit der Seilbahn auf den Zuckerhut gefahren. Als wir oben waren, wollte ich ein Foto machen, dafür haben alle ihre Trikots angezogen. Und plötzlich war die Hölle los: Brasilianische Kinder kamen auf uns zugestürmt, alle wollten mit den Spielern fotografiert werden. Auf einmal wurden die Jungs behandelt wie richtige Stars! Die Stimmung war in Rio die ganze Zeit über genial. Die beiden Spielfelder waren am Strand von Copacabana aufgebaut – eine unglaubliche Kulisse. Es war angenehm warm, die Leute sind nach jedem Spiel ins Meer gesprungen. Rund um das Turniergelände spielten die Kinder im Sand Fußball – und abends haben sie gebettelt, dass sie noch mit dem deutschen Team kicken durften.
Auf dem Platz waren alle fair. Das ist bei 440 Spielern aus 49 Ländern ja überhaupt nicht selbstverständlich, zumal sie alle in irgendeiner Form Erfahrungen mit Obdachlosigkeit, Armut, Drogen oder Gewalt gemacht haben. Das Niveau der Teams war zum Teil sehr unterschiedlich, aber es gab zum Glück viele gute Verlierer.
Ich fand auch, dass die deutsche Mannschaft als Team gut funktioniert hat. Das war echt eine coole Truppe. Und das, obwohl sie so unterschiedlich sind: Der jüngste Spieler, Patrick Bochmann aus Leipzig, ist gerade mal 18 Jahre, die Ältesten sind mehr als doppelt so alt. Zum Glück war Jiri Pacourek aus Nürnberg dabei, der hat das Team zusammengehalten und öfter mal Streit geschlichtet. Den gab es vor allem gegen Ende des Turniers, als nach der Niederlage gegen die Philippinen am sechsten Spieltag klar wurde, dass das deutsche Team es nicht auf die vorderen Plätze schaffen würde. Am Ende haben sie den 32. Platz erreicht, da waren schon einige enttäuscht.
Ein schwerer Schlag war auch die Verletzung von Torwart Steven Duda aus Bensheim: Der hat sich am dritten Spieltag den Finger gebrochen und musste von da ab vom Spielfeldrand aus zusehen. Und Thiago Keller aus Gifhorn wurde nachts von sechs Jugendlichen mit vorgehaltenem Messer ausgeraubt – zum Glück ist ihm nichts passiert! Aber trotz aller Probleme hat das Team bis zum Schluss super zusammengehalten. Ich freue mich schon darauf, nächstes Jahr nach Paris zu fahren – mal gucken, ob die Brasilianer dort ihren Titel verteidigen können!
Ich bin Schillers Handelsvertreter
Davon kann man leben? Lutz Görner ist der wohl einzige hauptberufliche Poesie-Rezitator Deutschlands. Im November liest er in der Altonaer Kulturkirche sein Programm „Opiumschlummer und Champagnerrausch“ zugunsten von Hinz&Kunzt.
Görner zetert: „Sein Glück für einen Apfel geben, oh Adam, welche Lüsternheit.“ Wer das geschrieben hat, heißt Gottfried Ephraim Lessing.
Görner stöhnt: „Die müde Seele ruft dem großen Tröster zu, das Fleisch riecht schon nach Gruft.“ Wer das geschrieben hat, heißt Andreas Gryphius.
Görner jubiliert: „Freude, schöner Götterfunken …“ Wer das geschrieben hat, heißt Friedrich Schiller.
„Görner liest Schiller – Opiumschlummer und Champagnerrausch“ heißt das aktuelle Programm von Deutschlands „wohl berühmtestem Rezitator“ (Görner und praktisch alle Kritiker über Görner) deutscher Lyrik. Seit mehr als 35 Jahren schreit und wispert, faucht und ächzt der 65-Jährige auf den Bühnen dieses Landes, wenn er aus den Lebenswerken großer deutscher Dichter deklamiert.
Ein Mann mit einer Mission. Germanistik hatte er studiert an der Hochschule zu Köln, Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte, Philosophie und Soziologie. Er ging ans Theater, wollte Intendant sein, der erste Mann am Hause. Er wurde Schauspieler, Bühnenarbeiter, Requisiteur, Dramaturg und Regieassistent in Köln, München und Hamburg – und hatte bald keine Lust mehr. „Weil die Leute, mit denen ich zusammen war, mir einfach nicht genügten und das viele Gequatsche und Diskutieren mir auf die Nerven ging.“ Heinrich Heines „Harzreise“ bekam er in die Hände, da war er 29, studierter Germanist und kannte Heine gar nicht. „Da dachte ich, den kennen andere auch nicht.“ Also baute er ein Heine-Programm, trat damit auf und bekam so viel Beifall, dass er mitten in der Spielzeit sein Engagement am Münchner Theater der Jugend kündigte.
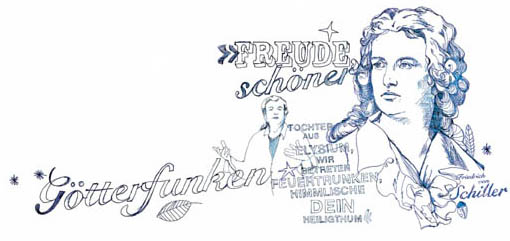
„Seitdem habe ich nie wieder was anderes gemacht. Und seitdem schreibt mir niemand mehr etwas vor. Wenn ich Fehler mache, dann mache ich die selber und das ist sehr angenehm. Ich wollte Intendant werden und das bin ich jetzt auch – mein eigener.“
Neben seinen Liveshows hat Görner bis heute Dutzende CDs, MCs, LPs und DVDs produziert, rund drei Millionen der Tonträger verkauft. Seine Sendung „Lyrik für alle“ läuft seit 1993 jeden Sonntag im 3sat-Fernsehen, im Schnitt schauen rund 250 000 Zuschauer zu. Für Nachwuchs sorgt er außerdem: Etliche habe er ausgebildet, annähernd so erfolgreich wie er selbst ist kaum einer. „Da gehört anscheinend mehr dazu als nur der Wunsch.“
Der Meister selbst bereitet im intensiven Studium seine Programm vor, manchmal drei Jahre lang. „Das dauert bei mir immer so lange und deswegen hat das so eine hohe Qualität.“ Mit etwas, das ihn selbst nicht vollkommen überzeugt, würde er sich nie auf eine Bühne stellen. Rainer Maria Rilke und Hermann Hesse zum Beispiel hat er von jeher ausgelassen. Aus politischen Gründen. „Der berühmte Herr Rilke oder der Herr Hesse, das sind so Traumtänzer, die so tun, als wenn nichts sie irgendetwas anginge“ – ein Verhalten, mit dem Görner nichts anfangen kann. Er selbst wurde Anfang der 80er-Jahre, als er in St. Georg lebte und am Thalia Theater arbeitete, Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP). „Ich war vorher in New York, da habe ich dieses wölfische Wesen kennengelernt, diese kapitalistische Fratze. Und dann hab’ ich gedacht: ,Was mach ich jetzt?‘“ Er wurde Kommunist. „Dann habe ich aber gemerkt, dass das Quatsch ist. Aber ich bin immer noch ein Linker.“
Zwangsläufig, findet er: „Die Welt ist, das weiß doch jeder, ungerecht. Und unsere ist vielleicht noch die ungerechteste, weil wir die übrige Welt ausbeuten und denken: ,Das kümmert mich nicht.‘ Dabei haben letztlich alle, die wir hier leben, unsere Schippe Schuld, ob wir arm sind oder reich. Es gibt nicht einen vernünftigen Menschen auf dieser Erde, der nicht zumindest ähnlich denkt.“ Darunter die Dichter, die Görner auswählt. Jene, die er auslässt, gehören für ihn nicht dazu, denn „natürlich gibt es auch unter Dichtern FDP-Wähler“.
Was Görner auch nicht einsieht: Schillers Balladen. Gerade die hätten ihn so lange überhaupt von Schiller abgehalten, sagt er. 35 Jahre lang habe er einen Bogen um ihn gemacht. Dann, angespornt von einem befreundeten Germanistikprofessor, las er haufenweise Biografien und entdeckte Schiller für sich, oder besser: die zwei Schillers. „Den einen vor seiner Ehe und den einen danach, so einen Opium-Champagner-Schiller, und den häuslichen, bürgerlichen.“ Beim abhängigen, von schwerer Krankheit gezeichneten Dichter „ist eigentlich alles schiefgegangen“, sagt Lutz Görner, „und trotzdem hat er dieses gigantische Werk aus diesem kranken Körper herausgeholt, und das ist natürlich bewundernswert.“
Über sein aktuelles Programm, mit dem er in diesem Jahr zum zweiten Mal durchs Land tourt, sagt Görner: „Noch nie war die Begeisterung meines Publikums so einhellig wie bei diesem Programm. Pfeifen, Trampeln, Klatschen, Standing Ovations. Das hat Glückshormone bei mir ausgelöst.“ Weil es heißt, dass er einen Weg gefunden hat, Menschen dazu zu bringen, Schiller zu lieben. „Jemand, der sich nicht so wie ich die ganze Zeit mit dem Zeugs beschäftigen kann, der kriegt – flatsch – in zwei Stunden von mir was Gutes hingelegt.“ Görner sieht sich selbst als Animateur zum Lesen, als Entertainer der Lyrik, als der „Handelsvertreter“ von Goethe, Schiller und den anderen. „Ich preise den dann an, was das für ein toller Hecht ist, und dass es sich so lohnt, den zu lesen und hoffe, dass ich ein paar Leute dazu kriege.“
Text: Beatrice Blank
Illustration: Mirja Winkelmann
Görner liest Schiller – Opiumschlummer und Champagnerrausch, Benefizveranstaltung für Hinz&Kunzt: Kulturkirche Altona, Max-Brauer-Allee, Samstag, 13. November, 20 Uhr, 15/10/8/5 Euro, VVK bei Hinz&Kunzt, Tel. 32 10 83 11.
„Nicht mal ein Taschentuch konnten wir mitnehmen“
Als Kind spielte Adrienn Fuchs auf den Dämmen der Rotschlammbecken von Kolontár. Als der Wall Anfang Oktober brach, verlor sie ihre Großmutter und ihr Elternhaus. Niemand weiß, ob der Landstrich je wieder bewohnbar sein wird. Ein Dorf ist obdachlos.
Adrienn Fuchs hat die Schutzmaske auf die Stirn geschoben und ruft nach ihrer Katze. „Ciza!“ Ihre zarte Stimme geht im Dröhnen der Bulldozer unter. „Vielleicht hat sie sich in einen Baum gerettet“, sagt die zierliche 29-Jährige mit dem langen dunklen Haar und zieht den Atemschutz wieder vor Nase und Mund. Die Luft beißt. In Fischerhose und Regenparka stapft sie weiter über das Stück Land, das einmal ihr Zuhause war. Vorbei am Gartenzaun, der jetzt auf dem Boden klebt, zu dem Haufen Balken und Bretter, die vom Schafstall übrig geblieben sind. Vielleicht versteckt sich die Katze hier. „Ciza!“ … Diese Geschichte und die Fotos dazu: Exklusiv in der Hinz&Kunzt-Novemberausgabe.
Text: Mathias Becker
Fotos: Antonia Zennaro
„Hinterher bereut man alles“
Wolfgang (49) verkauft seit drei Monaten Hinz&Kunzt und steht gemeinsam mit seiner Verlobten, auch Hinz&Künztlerin, vor dem Aldi-Markt in der Horner Landstraße.
„Wir brauchen mehr günstige Wohnungen“
Michael Sachs, Hamburgs neuer Wohnungsbaukoordinator, über dringend benötigten Neubau, die Wohnungskrise und die Frage, warum seit Jahren zu wenig günstiger Wohnraum gebaut wird.
 Hinz&Kunzt: Herr Sachs, Sie sind jetzt seit fast einem halben Jahr Hamburgs neuer Wohnungsbaukoordinator. Ist der Job so, wie Sie ihn sich vorgestellt haben?
Hinz&Kunzt: Herr Sachs, Sie sind jetzt seit fast einem halben Jahr Hamburgs neuer Wohnungsbaukoordinator. Ist der Job so, wie Sie ihn sich vorgestellt haben?
Michael Sachs: Meine Aufgabenstellung ist ziemlich klar – ich soll den Wohnungsbau in Hamburg befördern. Was mich schon überrascht hat, sind die Probleme, mit denen Hamburg konfrontiert ist, wenn Wohnungen gebaut werden sollen.
H&K: Können Sie uns dafür bitte ein Beispiel geben?
Sachs: Jemand möchte an ein Haus mit vier Wohnungen einen genauso großen Anbau machen. Dem sagt das Bezirksamt: „Machen Sie mal einen Architektenentwurf und stellen Sie einen Antrag.“ Dann gibt der Geld aus, macht den Entwurf, stellt den Antrag und erhält eine Ablehnung mit dem Hinweis, es müsse ein reguläres Bebauungs-Verfahren gemacht werden. Dann macht der dafür die Vorarbeiten, holt Gutachten ein, seine Kosten liegen dann schon irgendwo bei 100.000 Euro. Und zum Schluss, nach sechs Jahren, sagt der Stadtplanungs-Ausschuss des Bezirks: „Das bleibt grün.“ Oder eine Baugenossenschaft möchte in Barmbek eine Baulücke schließen. Das ist das zentrale Thema im Moment. Die erhält einen Ablehnungsbescheid mit dem Hinweis, dass eine Lücke bleiben müsse, damit die im Innenhof befindlichen Insekten und Reptilien den Kontakt zur Außenwelt nicht verlören. Die Beispiele zeigen: Lange Verfahren und unzählige Auflagen erschweren das Bauen in Hamburg.
H&K: Sie dürfen dem Ersten Bürgermeister Ihre Anliegen vortragen und der Stadtentwicklungssenatorin vorschlagen, wo gebaut werden könnte. Wünschen Sie sich manchmal auch Entscheidungsbefugnisse?
Sachs: Wer wünscht sich die nicht? Ich weiß aber, dass meine Rolle überhaupt nicht installiert worden wäre, wenn ich hier entscheiden könnte. Dann wären die Bedenken gegen eine Art Terminator – statt Koordinator – riesig gewesen. Ich bin jemand, der versucht, über Koordinierung und Gespräche Prozesse zu beschleunigen. Entscheiden müssen die zuständigen Behörden.
H&K:Der Altonaer CDU-Politiker Sven Hielscher hat kürzlich gesagt, dass die Wirtschaftsbehörde zu oft ihre Hand über leere Gewerbeflächen hält, auf denen Wohnungen gebaut werden könnten. Hat er recht?
Sachs: Die Stadt hat die Notwendigkeit, eine gewisse Vorratspolitik zu betreiben mit Wirtschaftsgrundstücken. Betriebe kommen ja nicht geplant in bestimmter Zahl zu bestimmten Jahreszeiten, sondern sie kommen mit Konjunkturschüben. Auf der anderen Seite kann es nicht angehen, dass wir in einer Zeit, in der wir dringend Wohnungsbau in der inneren Stadt brauchen, Grundstücke ewig brachliegen lassen. Wir haben das auch aufgegriffen: Wir haben zum Beispiel das Grundstück Othmarschenpark, das bisher nur für Gewerbe vorgesehen war, aufgeschlossen, und jetzt werden dort 600 Wohnungen gebaut. Es gibt noch einige solcher Grundstücke in der Stadt.
H&K: Beim Bau der östlichen Hafencity sind 2800 Wohnungen geplant, aber doppelt so viel Fläche für Büros. Ist das eine intelligente Planung?
Sachs: Intelligente Planungen sind einerseits die, die Investoren anziehen. Andererseits müssen die Leute, die da arbeiten und wohnen sollen, das Quartier mögen. Deshalb steht und fällt die ganze Hafencity nicht mit der Menge an Büros, sondern mit der Frage, ob das ein gemischtes Quartier wird. Der Begriff Getto, den wir so gerne benutzen, wenn es sich um ausländische Haushalte handelt, trifft auch zu, wenn es sich nur um Besserverdienende handelt. Insofern wird es darauf ankommen, eine vernünftige Mischung in der Hafencity herzustellen, unter anderem dadurch, dass man dort auch preiswerte Wohnungen baut.
H&K: Aber müssten angesichts der Wohnungsnot nicht auch viel mehr Wohnungen gebaut werden?
Sachs: In den 60er- und 70er-Jahren hatten wir Wohnungsnot, deswegen war es richtig, Großsiedlungen wie in Steilshoop zu bauen. Stadtteile, die innerhalb von drei Jahren hochgezogen werden, helfen Wohnungsnot zu bekämpfen. Aber derzeit haben wir keine Wohnungsnot.
Deswegen sollte man mit dem, was wir im Moment bauen, sehr kalkuliert und vorsichtig umgehen und sich angucken, wo die Leute gerne wohnen wollen.
H&K: Wie bitte? Es gibt keine Wohnungsnot in Hamburg?
Sachs: Nein. Es gibt Spitzennachfragen in bestimmten Bereichen. Wir führen eine Diskussion über die Frage „Gibt es einen Anspruch von jungen Leuten, in Ottensen zu wohnen oder in der Schanze?“. Und da sage ich: Nein, so einen Anspruch gibt es nicht. Diejenigen, die sich darüber beklagen, dass es dort so teuer ist, sind Teil des Problems. Wenn alle da wohnen wollen, dann steigen die Preise.
H&K: Nebenbei fallen aber Tausende Sozialwohnungen aus der Mietpreisbindung …
Sachs: Die fallen aus der Mietpreisbindung, die fallen aber nicht in sich zusammen! Die sind dann noch da!
H&K: Aber wo sollen die Leute wohnen, die nur wenig Geld haben?
Sachs: Die Durchschnittsmiete in Hamburg liegt so etwa bei 6,50 Euro. Die Durchschnittsmiete im sozialen Wohnungsbau liegt bei etwa 5,70 Euro. Wenn heute eine Sozialwohnung am Osdorfer Born aus der Bindung fällt, dann darf die Miete in drei Jahren um 20 Prozent erhöht werden. Wenn sie jetzt fünf Euro pro Quadratmeter beträgt, würde sie in drei Jahren auf sechs Euro steigen. Das ist keine Explosion.
H&K: Aber nach zehn Jahren wären wir unter Umständen schon bei acht Euro pro Quadratmeter …
Sachs: Richtig. Aber vermieten Sie mal eine Wohnung für acht Euro am Osdorfer Born! Wenn wir über den Osdorfer Born reden, über Mümmelmannsberg, über Steilshoop, über Neuwiedenthal und Kirchdorf-Süd, dann haben wir
80 Prozent des Bestandes an Sozialwohnungen. Und dann sage ich Ihnen: Das Herausfallen aus der Bindung ist in diesen Quartieren nicht das Problem. Das ist überall dort ein Problem, wo es spekulative Prozesse gibt, in Ottensen, in der Schanze und St. Pauli. Da sind die meisten Sozialwohnungen aber noch so neu, dass sie noch gar nicht aus der Sozialbindung fallen. Man darf sich nicht verrückt machen lassen.
H&K: Müsste nicht trotzdem etwas gegen die Mietensteigerung getan werden?
Sachs: Natürlich. 75 Prozent aller Hamburger Haushalte verdienen unter 3200 Euro netto. Wenn wir eine Wohnungsbaupolitik weiter betreiben, die sich an Kapitalanlegern und Projektentwicklern orientiert, dann bauen wir an der Zahlungsfähigkeit der Hamburger vorbei. Aber das hängt nicht so sehr an den So-zialwohnungen, sondern am Preisgefüge des gesamten Marktes. Und da ist die Frage wichtig, wie die Stadt sich einbringt. Indem sie Bebauungspläne macht, indem sie eigene Grundstücke einsetzt, indem sie sozialen Wohnungsbau fördert. Die Preisschraube ist nur aufzuhalten, wenn wir ausreichend Wohnraum
bauen, wenn die Leute sich Wohnungen wirklich aussuchen können.
H&K: Also doch mehr Neubau. Woran liegt es eigentlich, dass die städtische Saga/GWG nicht mehr baut?
Sachs: Es stimmt nicht, dass Saga/GWG nicht baut. Sie haben auch in Zeiten, wo andere von Leerstand redeten, immer in kleiner Zahl weitergebaut. Die ordnungspolitische Veränderung, die hier in dieser Stadt stattgefunden hat nach 2001, hat bei der Saga/GWG erhebliche Veränderungen gebracht. Das war erst die Diskussion „Brauchen wir überhaupt ein öffentliches Wohnungsunternehmen?“, dann „Wir brauchen eins, aber das muss Geld abwerfen“ und dann „133.000 Wohnungen in einem kommunalen Unternehmen, das muss ja nicht sein. Es reicht auch, wenn es kleiner ist.“ Saga/GWG sollte einfach nicht mehr bauen.
H&K: Was soll eigentlich aus denen werden, die in Wohnunterkünften untergebracht sind? Müssten nicht ungenutzte Häuser geöffnet werden? In den Straßen rund um Santa Fu lässt die Stadt Dienstwohnungen leerstehen.
Sachs: Da sind wir dran, das soll eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme werden, auch mit Neubau.
H&K: Könnte man solche Objekte nicht vorher schon vorübergehend vermieten?
Sachs: Nein. Das Problem der Wohnungslosigkeit ist ein dauerhaftes soziales Problem. Ich glaube nicht, dass es dadurch gelöst ist, dass wir jetzt einfach mehr Wohnungen bauen. Und Leerstände – lassen Sie mich das mal sagen – sind heute ein Marginalproblem. Wenn man eine Planungsabsicht hat, bei der man die Objekte abreißen oder neu gestalten will, muss man irgendwann aufhören, die Häuser zu vermieten. Denn wir haben ein Mietrecht, wo der letzte Mieter bestimmt, wann ich anfangen kann zu arbeiten.
H&K: Wie lange, glauben Sie, wird die Lage für Wohnungslose schwierig bleiben?
Sachs: Ich glaube, dass es für Wohnungslose immer extrem schwierig ist. Ich bin dazu da, die Menge der gebauten Wohnungen zu erhöhen. Man hat es in den letzten Jahren gerade geschafft, zwischen 3500 und 4000 Wohnungen zu bauen, von denen die meisten auch noch zu teuer sind. Was wir jetzt brauchen, sind mehr Wohnungen in einem niedrigen oder mittleren Preissegment.
H&K: Sozialsenator Wersich hat uns gesagt, er befände sich mit Ihnen in intensiven Gesprächen darüber, wie preiswerter Wohnraum geschaffen werden kann.
Sachs: Das ist richtig, wir reden darüber, aber gerade die Unterkünfte sind auch ein Bereich, in denen der Sozialsenator selbst aktiv werden kann. Er hat die Zuständigkeit für fördern und wohnen, ein Unternehmen, das in Hamburg an vielen Stellen Unterkünfte betreibt, aber auch Flächen hat. Und auf den Flächen kann man auch Wohnungen bauen.
H&K: Ein Vorschlag von Herrn Wersich war ja, leer stehende Altenheime oder Krankenhäuser in Wohnraum umzuwandeln …
Sachs: Ach wissen Sie, das liegt in etwa auf der Ebene wie „Bürohäuser in Wohnungen umwandeln“. Jetzt frage ich mal ganz polemisch: Möchten Sie an der Nordkanalstraße wohnen? Ich will doch nicht Leute irgendwo hinbringen, nur weil sie eine Unterkunft brauchen, sondern ich will doch Quartiere schaffen, in denen man vernünftig leben kann, mit Nachbarschaft und Einkaufsmöglichkeiten. Das ist bei Krankenhäusern und Bürohäusern nicht immer der Fall. Und es macht auch dort keinen Sinn, wo ich im Grunde mit dem Aufwand eines Wohnungsneubaus ein Bürohaus oder Krankenhaus erhalte.
H&K: Was ist aus Ihrer Sicht das größte Hindernis beim Bau von günstigem Wohnraum?
Sachs: Das eine ist, dass Hamburg sich vorgenommen hat, Green Capital zu sein nächstes Jahr, europäische Umwelthauptstadt. So wie das in Hamburg im Moment gestaltet wird, bedeutet das, dass eigentlich nur noch Passivhäuser gebaut werden sollen. Dazu kommen viele Auflagen aus den Bezirken. Hier muss eine Baumgruppe erhalten werden, dort soll eine möglichst tolle Spiel- und Grünfläche gestaltet werden. Das macht alles im Einzelfall Sinn. Nur: Jede einzelne Idee kostet Geld. Alles, was da gut gemeint ist, auch unter ökologischen Gesichtspunkten vernünftig ist, verteuert die Miete. Wenn ich mich als Abgeordneter beschwere über die Preissteigerung in St. Pauli, dann sollte ich irgendwann sagen: „Vielleicht ist es nicht nötig, da den ökologischen Musterknaben zu bauen, sondern einfach preiswerten Wohnraum.“ Das hat man politisch in der Hand.
H&K: Können Sie verstehen, wenn junge Leute aus Verzweiflung wieder anfangen, leer stehende Häuser zu besetzen?
Sachs: Natürlich kann ich das verstehen. Eine Lösung ist das nicht.
Interview: Hanning Voigts und Ulrich Jonas
Foto: Benne Ochs
88 Tage Hölle
Daniela Matijevic war als Soldatin im Kosovo. Die junge Frau musste dort am Öffnen von Massengräbern teilnehmen, sah Dorfbewohner und Kameraden sterben. Elf Jahre später leidet sie noch immer unter den Erlebnissen – und fordert von der Gesellschaft mehr Respekt.
„Die Angst kommt hinterher“
Mitten rein ins Geschehen, um die Welt besser zu begreifen: Marc Thörner berichtet für die ARD aus dem Nahen und Mittleren Osten. Im Irak und in Afghanistan begleitet er ausländische Truppen und versucht, die Einheimischen zu verstehen. Frank Keil sprach mit dem Hamburger Autor und Hörfunkjournalisten über seine Erlebnisse in Kriegs- und Krisengebieten.
Er fährt langsam dem Militärkonvoi hinterher. In einem gelben Taxi, unterwegs von Kabul nach Kundus, vor ihnen gepanzerte Fahrzeuge der Bundeswehr. Sein Fahrer hält gut 40 Meter Abstand. Plötzlich stoppt der letzte Wagen des Konvois, Soldaten steigen aus. Einer von ihnen legt an – und schießt. Zum Glück ist es nur Signalmunition, die neben dem Taxi in einem Weizenfeld zerplatzt. Ein deutscher Offizier im Feldlager von Kundus wird Marc Thörner hinterher sagen, dass so ein Beschuss zwar gewaltig aussehe, aber harmlos sei. Es sei auch nur die erste von mehreren Eskalationsstufen gewesen, fühlten sich die Soldaten von einem zivilen Fahrzeug bedroht. Marc Thörner sagt: „Ich saß oft genug selbst in einem Bundeswehrfahrzeug und weiß, wie bedrohlich es sich anfühlt, wenn sich ein Auto nähert.“ Und weiter: „Als es neben uns knallte, habe ich mich plötzlich gefühlt wie ein stinknormaler Afghane – und ich habe zugleich verstanden, warum es zwischen den Einheimischen und den ausländischen Truppen so viel Misstrauen gibt; warum so viel schiefläuft.“
Eigentlich mag Marc Thörner, der als Autor und als Hörfunkjournalist für die ARD aus dem Nahen und Mittleren Osten berichtet, solche Geschichten nicht: Berichte, wo es knallt und raucht; wo etwas explodiert. Doch er hat diese Geschichte erzählt, damit klar wird, was ihn beschäftigt: wie unterschiedlich die Welt aussieht, je nachdem von welcher Warte aus man sie betrachtet. Entsprechend antwortet er bedächtig, setzt kurze Pausen zwischen den Sätzen. „Ich mag keinen Journalismus, der einfach nur Beobachtungen aneinanderreiht.“
Es hat ihn früh in die arabisch-islamische Welt gezogen: „Ich bin mit meinen Eltern schon als 15-Jähriger nach Marokko gereist und fand dort gerade die vielen Verbote aufregend: Warum durften wir nicht in Moscheen hinein? Warum warteten Leute vor dem Hotel und ließen den ganzen Tag nicht von uns ab? Und dann natürlich die verschleierten Frauen – wirklich sehr faszinierend.“
Nach dem Abitur studiert er Geschichte, als Schwerpunkt im Hauptstudium wählt er die arabische Welt, die er seitdem immer wieder besucht. Eine Zeit lang lebt er in Marokko.
 Heute wohnt er mit seiner Familie in Langenhorn, in einem Reihenhaus, umrahmt von einer struppigen Hecke und einem Jägerzaun, in der Mitte eine niedrige Pforte, die man etwas anheben muss, damit sie sich öffnet und wieder schließt. Gern ist er mit dem Fahrrad unterwegs, fährt lange Strecken, etwas einkaufen, etwas besorgen oder auch einfach so, um abzuschalten; um das Erlebte zu filtern und zu ordnen. Ganz nebenbei hat er in Hamburg die ganz normalen Probleme ganz normaler Väter: zum Beispiel zu beurteilen, welche weitergehende Schule womöglich die richtige für seine Tochter sein könnte.
Heute wohnt er mit seiner Familie in Langenhorn, in einem Reihenhaus, umrahmt von einer struppigen Hecke und einem Jägerzaun, in der Mitte eine niedrige Pforte, die man etwas anheben muss, damit sie sich öffnet und wieder schließt. Gern ist er mit dem Fahrrad unterwegs, fährt lange Strecken, etwas einkaufen, etwas besorgen oder auch einfach so, um abzuschalten; um das Erlebte zu filtern und zu ordnen. Ganz nebenbei hat er in Hamburg die ganz normalen Probleme ganz normaler Väter: zum Beispiel zu beurteilen, welche weitergehende Schule womöglich die richtige für seine Tochter sein könnte.
Diese Wochen in Hamburg tun ihm gut. Hier findet er die Ruhe und Zeit, all das zu verarbeiten, was er erlebt hat – auch um daraus seine Artikel und Reportagen zu schmieden. Und was er erlebt, das hat es in sich: Er ist etwa zum Ausbruch des zweiten Irakkrieges in Kairo und erlebt dort hautnah die Proteste gegen diesen Krieg – und auch den wütenden Protest der Leute gegen ihre eigene Regierung, die den US-Einmarsch unterstützt. Er geht in den Irak, ist als Reporter mitten unter den kämpfenden Soldaten; erlebt mit, wie junge Offiziere im Alter von gerade mal 24, 25 Jahren ihre Einheiten durchs Kampfgeschehen führen. Natürlich hat er einige der Soldaten dabei gut kennengelernt, muss manchmal an sie denken; fragt sich, wie es ihnen wohl ergangen ist und ob sie überhaupt noch leben: „Dass man eine bestimmte Verteidigungspolitik aus seinen Kenntnissen heraus ablehnen muss, heißt ja nicht, dass man die Menschen ablehnt, die dort großen Risiken ausgesetzt sind.“
Überhaupt mag er es, sich mitten ins Geschehen zu begeben – nicht um den draufgängerischen, unerschrockenen Reporter zu mimen, sondern um selbst zu erleben, was in dieser fremden Welt eigentlich los ist. Wie damals, als er im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan unterwegs war. „Ich habe mich zwei Tage lang gefragt, was hier nicht stimmt und bin einfach nicht drauf gekommen.“ Dann fällt es ihm schließlich auf: „Es waren absolut keine Frauen zu sehen! Nirgends. Nur Männer mit Turbanen und Bärten und Kalaschnikows. Das ist noch mal anders, als wenn man in einer afghanischen Provinzstadt auf der Straße ist, wo die Frauen verschleiert sind, vielleicht auch eine Burka tragen, aber wo sie doch da sind.“ Bedrückend sei das gewesen – und sehr, sehr anders. Er schweigt einen Moment, holt neuen Schwung: „Und gleichzeitig gab es in dieser reinen Männerwelt eine absolute Offenheit, eine große Geborgenheit. Du hast das Gefühl, du bist in Abrahams Schoß.“ Die Leute würden alles für einen tun, einen rund um die Uhr bewachen und schützen: „Dabei hab ich mich bei Diskussionen über Religion oder Politik so gar nicht mit meinen Gastgebern verstanden – aber menschlich spielte das keine Rolle.“ Und er setzt wieder eine Pause und sagt: „Mir ist damals klar geworden, warum sich bestimmte Leute dort so gut verstecken können.“
Aber hat er nicht zwischendurch furchtbare Angst gehabt, besonders wenn er zusammen mit Soldaten unterwegs war? Marc Thörner schüttelt den Kopf: „Nein. Denn als Radiomensch guckst du sehr auf die Technik. Du überlegst, wie kannst du jetzt die Situation am besten dokumentieren? Ich kann ja nicht sagen: ‚Halt, stopp – ich hab mein Mikrofon noch nicht ausgepegelt. Könnt ihr mit der Personenkontrolle noch mal von vorne anfangen?‘“
Wenn noch Zeit ist, versucht er zu verstehen, was passiert: „Was ist das für eine Moschee, die durchsucht werden soll? Warum ist die verdächtig? Oder warum wird jenes Gehöft gerade angegriffen? Und wer sind die Aufstandsführer, die man zu schnappen versucht? Das verlangt alle Aufmerksamkeit. Die Angst kommt hinterher. Wenn man wieder zu Hause ist. Da hab ich mich dann schon manchmal komisch gefühlt – aber nie in der Situation selber.“
Er kommt noch mal auf seinen Job zu sprechen, erzählt ganz begeistert, dass er gerne früh aufsteht, dann in seinem Arbeitszimmer am PC sitzt, wenn die anderen noch schlafen, und wie froh er ist, dass er Radio macht, wo er selbst etwas erzählen kann – und kein Fernsehen: „Wer Fernsehen macht, braucht heutzutage Bilder, die sexy sind. Bilder, wo schnell etwas passiert: interessant aussehende Militärfahrzeuge, die röhrend anfahren; Soldaten, die losrennen, irgendwo in Deckung gehen, weiterstürmen.“ Er muss kurz grinsen: „Ich weiß nicht, wie viele Bilder es aus dem Afghanistankrieg gibt, in denen eine Patrouille durch eine Gasse geht – Schnitt – und dann wird mit großem Gerumpel eine Metalltür eingetreten.“ Solche Fernsehbilder würden die Konflikte auf das Militärische reduzieren; auf Angriff und Verteidigung. Gesendet zwischen dem letzten Koalitionsstreit, dem Neuesten zur Gesundheitsreform und dem Wetterbericht, verpackt in einer Minute und 30 Sekunden: „Deswegen verstehen so viele Zuschauer gar nicht, was da wirklich passiert.“ Nachdenklich sagt er: „Die Geschichte fängt doch erst an, wenn die Soldaten mit den Leuten reden, die in dem Haus sind, dessen Tür sie gerade eingetreten haben. So aber lernt man nichts über den Krieg.“
Text: Frank Keil
Foto: Hannah Schuh
Als Buch ist von Marc Thörner zuletzt erschienen „Afghanistan-Code – eine Reportage über Krieg, Fundamentalismus und Demokratie“, Edition Nautilus (2010), 156 Seiten, 16 Euro.
Von tierischen Teebeuteln und der Dreiheiligkeit
Fleischeslust bei Hinz&Kunzt: In seinem Restaurant Bullerei verrät Tim Mälzer unserer Kochgruppe, wie man Rind und Huhn perfekt zubereitet. Diese und noch viel mehr spannende Geschichten und Rezepte rund ums Essen servieren wir ab Mitte November in unserem neuen Hinz&Kunzt-Sonderheft „Hamburger Kochschule“.
 Wie bereitet man ein saftiges Steak zu, ohne es zu Tode zu braten? Was muss beim Schmoren beachtet werden? Und woran erkennt man überhaupt gutes Fleisch? Wir haben viele Fragen mitgebracht, die wir Tim Mälzer stellen wollen. Der Chef der „Bullerei“ will uns in einem Grundkurs „Fleisch“ in die Geheimnisse der Fleischzubereitung einweihen. Ihm zur Seite steht der Fleischlieferant seines Vertrauens: Schlachter Michael Wagner.
Wie bereitet man ein saftiges Steak zu, ohne es zu Tode zu braten? Was muss beim Schmoren beachtet werden? Und woran erkennt man überhaupt gutes Fleisch? Wir haben viele Fragen mitgebracht, die wir Tim Mälzer stellen wollen. Der Chef der „Bullerei“ will uns in einem Grundkurs „Fleisch“ in die Geheimnisse der Fleischzubereitung einweihen. Ihm zur Seite steht der Fleischlieferant seines Vertrauens: Schlachter Michael Wagner.
Wir stehen erwartungsvoll auf der einen Seite des Küchentresens, um den sich auch in Tim Mälzers Kochsendung alles dreht. Der Meister, der Spaß am Kochen vermitteln will, steht auf der anderen und betrachtet prüfend das Fleisch. Schlachter Wagner hat reichlich Ware mitgemacht: Brust und Oberschalendeckel vom Rind, Hühnerkeulen, Schweinebauch sowie Lammnacken und -brust. Das ist selbst für einen Profi kaum in drei Stunden zu schaffen. Tim Mälzer entscheidet sich für Rind und Huhn. „Damit können wir kurzbraten, schmoren und kochen.“ Aber vorher möchten wir noch wissen, woran man denn nun die Qualität von Fleisch erkennt? Es muss gut abgehangen sein und hat seinen Preis. „Für 12 Euro gibt es kein Filet“, erklärt Tim Mälzer knapp. „Ich esse gern Fleisch, aber am Ende des Tages liegt ein Tier vor uns. Und bei billigem Fleisch wird immer am Tier gespart.“ Nachdenklich betrachtet er die Verkäufer und fügt hinzu. „Ich weiß, dass ihr euch finanziell einschränken müsst, aber in meinem Leben dreht sich eben alles um Essen und Genuss.“ Außerdem bereiten wir heute ja auch aus relativ günstigen Fleischteilen wie der Brust eine leckere Mahlzeit zu.
Wir beginnen mit dem Schmorgericht; das braucht am längsten. Michael Wagner reicht ihm die Oberschale, ein Teil der Innenseite der Keule. Deren Deckel ist ideal für Gulasch. „Wer möchte das Fleisch zerteilen?“, fragt Mälzer. Gerrit meldet sich. Das ist keine Herausforderung für den gelernten Schlachter. Zumal das Fleisch vor dem Zerteilen nicht mal pariert werden muss. Das heißt, Sehnen und Fett bleiben dran. „Die Sehnen sitzen wie Nylonstrümpfe am Fleisch und ziehen sich beim Garprozess zusammen, aber beim langen Schmoren dehnen sie sich wieder und zerfallen“, erklärt Tim Mälzer. Schnell hat Gerrit das Fleisch in gleich große Stücke zerteilt. Mälzer mischt etwas Mehl unter die Fleischwürfel sowie Salz und Pfeffer. „Mehl oder nicht ist Ansichtssache. Ich habe nichts dagegen, solange es nicht so viel ist wie bei der Oma. Das gibt Bindung. Und ob ihr vorher oder nachher würzt, ist auch Glaubenssache. Ich mache es immer vorher.“ Jetzt kommt das Fleisch zum Anbraten in die Pfanne mit dem heißen Öl.
„Das Schmoren funktioniert immer gleich“, erzählt Mälzer, während er die Würfel ins heiße Fett gibt. „Kräftig anbraten, das gibt Geschmack. Dann herausnehmen und die ‚Dreiheiligkeit‘ dazu.“ Dazu gehören Karotten für die Süße, Lauch oder Zwiebeln für die Schärfe und Sellerie für die Würze. „Welche Geschmacksrichtungen kennt ihr denn“, will der Koch von uns wissen. „Es sind fünf.“ Die Begriffe süß, sauer, bitter und salzig fallen. Kleine Pause. „Scharf“, sagt jemand. „Falsch, kein Geschmack, das ist ein Schmerz. Nummer fünf ist ‚umami‘“, weiß Mälzer. Umami ist die japanische Bezeichnung für einen Geschmackseindruck, der vor allem durch Glutaminsäure vermittelt wird und sinngemäß so viel wie Schmackhaftigkeit bedeutet.
Während das Fleisch brutzelt, schnippeln wir Gemüse. Das wird nach dem Fleisch ebenfalls braun angebraten. Dann folgen die Gewürze wie Lorbeer („nicht zu ängstlich“), Sternanis („nicht zu viel, sonst wird es Weihnachtsbäckerei“) und Kümmel. Bei dunklen Soßen darf Tomatenmark nicht fehlen („bringt Säure, Bindung und Farbe“). Der Wein zum Ablöschen fällt heute aus und wird durch einen Schuss Balsamessig und Wasser ersetzt. Die Fleischwürfel dürfen jetzt wieder mit in die Pfanne, und nun muss das Ganze anderthalb bis zwei Stunden kochen. „Aber nicht wie Wäsche, nur köcheln“, mahnt Mälzer.
Das war Teil eins der Lektion. Nach dem Schmoren lernen wir nun das Kochen. „Jedes Fleisch mit viel Bindegewebe ist dafür geeignet“, erklärt der Koch. „Und für besonders intensiven Geschmack sorgen Knochen, die tierischen Teebeutel.“ Wir nehmen uns die Rinderbrust vor. „Ihr müsst euch vorher entscheiden, ob ihr am Ende eine starke Brühe oder aromatisches Fleisch essen möchtet. Wenn es eine Brühe sein soll, wird alles im Topf kalt aufgesetzt.“
So machen wir es: Die Brust wandert im Ganzen hinein. Dazu kommen walnussgroße Stücke der „Dreiheiligkeit“, außerdem Gewürze wie Piment, Salz, Zucker und Pfeffer. Auch die Tomate für Farbe und Geschmack darf hier nicht fehlen. Jetzt nur noch köcheln lassen und ab und zu den Eiweißschaum und das Fett abnehmen, die sich an der Oberfläche der Brühe bilden. „Da kann man gar nichts falsch machen. Wenn das Fleisch nicht mehr die Konsistenz eines Radiergummis hat, sondern faserig ist, ist alles gut.“
Gulasch und Suppe benötigen jetzt nur noch Zeit zum Garen. Wir können uns anderen Dingen zuwenden. Tim Mälzer schlägt vor, aus den Hühnerkeulen ein Frikassee zuzubereiten. „Ein echtes Seelenessen: Für mich ist es die Bolognese, für meine Süße das Hühnerfrikassee.“ Klassischerweise wandert dafür ein ganzes Huhn in den Topf, aber wenn es schnell gehen soll, genügen auch die Keulen. Geschickt löst Tim Mälzer das Fleisch vom Knochen und schneidet es in mundgerechte Stücke. Es wird mehliert und in einer Butter-Mehl-Mischung leicht angedünstet – Experten nennen das „anstoven“. Dazu geben wir blanchierten, also kurz gekochten und abgeschreckten grünen Spargel und Erbsen. „Eigentlich muss man außer Bohnen kein Gemüse blanchieren. Das ist nur für den Erhalt der Farbe. Dafür das Wasser stark salzen.“ Für den typischen Hühnerfrikassee-Geschmack sorgen außerdem Pilze, in unserem Fall edle Steinpilze statt Champignons sowie Zitronensaft und Estragon.
Während wir genüsslich unsere Probierportion vertilgen, erzählt Verkäufer Stefan von der weniger edlen Variante eines Frikassees, das er auf Platte gekocht hat. „Ich habe Brühe mit Margarine, Mehl und Milch gekocht, dazu gab es Saft aus der Plastikzitrone und Reis. Eine Woche lang jeden Tag.“ Auch Tim Mälzer hat schon kulinarisch schlechte Zeiten erlebt. „Eine Zeitlang habe ich nur gekörnte Brühe gekocht und rohe Spaghetti gegessen.“ Natürlich sei das nicht mit der Not von Stefan zu vergleichen, räumt er gleich ein.
Es ist Zeit für den letzten Teil unseres Grundkurses: das Kurzbraten. „Ich weiß gar nicht, warum die Leute sich dabei immer so anstellen“, wundert sich Mälzer. „Das ist wirklich ganz simpel.“ Zunächst müsse man das Fleisch rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, damit die Temperaturunterschiede nicht ganz so groß seien. Dann wieder die leidige Gewürzfrage klären. Er salze vorher und ab in die Pfanne mit heißem Fett. „Wollt ihr ein ganzes Stück braten oder ein Steak?“ Beides natürlich. Kein Problem, denn das Prinzip ist das gleiche: Beidseitig anbraten und in Alufolie ruhen lassen, damit sich die Fasern entspannen können. Das große Stück wandert dann noch mal zum Weitergaren in den heißen Ofen. Zwischendurch dürfen wir immer mal wieder mit dem Finger in das Fleisch drücken und fühlen, wie weich es ist. „Es kann sich anfühlen wie der Arsch einer 16-Jährigen, einer 30-Jährigen oder einer 80-Jährigen, hat mein Küchenchef früher immer gesagt“, erzählt Mälzer grinsend. Es geht allerdings auch anders: mit dem Daumentest. Das Fleisch ist noch blutig, wenn es sich anfühlt wie der Daumenballen, wenn man Daumen und Mittelfinger locker zusammenlegt. Durchgebraten ist es, wenn es sich anfühlt wie der Daumenballen bei zusammengelegtem Daumen und kleinem Finger.
Währenddessen bereiten wir unter Mälzers Regie seine Lieblingssoße für Kurzgebratenes zu, eine Salsa verde aus Zwiebeln, sauren Gurken, Öl, Essig und Kräutern. Und Balu, unser Wald- und Pilzexperte, brät in Butter seine selbst gesammelten Fetten Hennen. Ein seltener Pilz, der optisch an einen Badeschwamm erinnert und nur an alten Kiefern wächst, die Rotfäule hatten. Zusammen mit dem medium rare gebratenen Fleisch schmecken sie köstlich. Das große Stück ist einen Tick zu roh, findet der Koch, erntet aber Widerspruch. „Genau richtig“, urteilt die Mehrheit.
Unser Kurs ist zu Ende. „Wir können gern noch mal einen Aufbaukurs machen, wenn ihr wollt“, sagt Tim Mälzer. Wollen wir. Lamm und Schweinebauch von Schlachter Wagner haben wir schließlich noch gar nicht angerührt. Noch eine ganze Weile stehen wir um den Küchentresen und reden. Über Essen, über Lebenskrisen und darüber, wie man sich wieder aufrappelt. Gemeinsames Essen öffnet eben nicht nur die Gaumen, sondern auch die Herzen.
Text: Sybille Arendt
Foto: Martin Kath